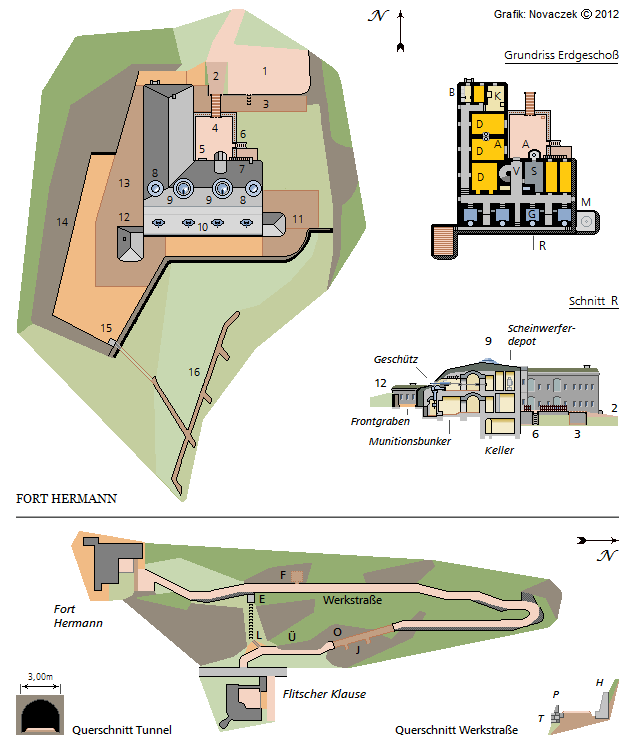| SONDERGALERIE AMATEURFOTOGRAF HANS NOVACZEK | |||
| Auf den Spuren des Gebirgskrieges 1915-1918 |
|
||
| 3. Die sechs Kärntner Festungen | |||
| 3.5 Fort Hermann | |||
|
|
|||
|
EINLEITUNG Die drei Schautafeln in Fort Hermann (1897-1900) geben nicht nur Auskunft über das Fort, sondern auch einen Überblick über die damalige Situation an der altösterreichisch-italienischen Grenze: |
|||
|
ÖSTERREICHICH-UNGARISCHE ALPINE ARTILLERIEFESTUNG FORT HERMANN
Schon 1797, 1805 und 1809 sind Napoleonische Einheiten durch das Tal der
Soca und über den Predelpass auf österreichisches Gebiet eingedrungen. Als
Österreich gegen Ende des 19. Jh daran ging seine Grenze zu Italien zu
befestigen, errichtete man an den Zugängen zu Tarvisio sechs so genannte
Kärntner Festungen. Die befestigte Straßensperre Flitscher Klause sowie die
1900 vollendete Artilleriefestung, benannt nach dem Verteidiger des
Predelpasses von 1809 Hauptmann Johann Hermann, bilden zusammen die
Flitscher Sperre. Von Fort Hermann konnten 13 Offiziere und 227 Soldaten mit
vier 120-mm Kanonen in gepanzerten Minimalschartenkasematten (die Reichweite
von 6700 m) und zwei drehbaren gepanzerten 105-mm Haubitzen auf dem Dach
(5900 m) fast das gesamte Flitscher Becken kontrollieren. Die Festung war
mit elektrischem Licht und einem Belüftungssystem ausgestattet. Sie verfügte
auch über Wasserleitungen und hatte an der Koritnica ein eigenes Kraftwerk.
Die italienische Artillerie beschoss in den ersten
Monaten des Krieges im Sommer 1915 Fort Hermann mit 3840 Granaten. Das Ziel
getroffen haben rund 200 Granaten, von denen manche 441 und 350 kg schwere
305-Millimeter Granaten waren. Sie wurden aus dem 13 km entfernten Tal der Raccolana hinter dem Kanin abgefeuert. Die Mannschaft hat sich während des
Beschusses zwar zurückgezogen, trotzdem kamen laut den bisher bekannten
Angaben 9 Soldaten ums Leben. Bis Mai 1916 war die Festung so stark
beschädigt, dass sie aufgegeben werden musste. |
|||
|
|
|||
|
Rückseite des Forts im Mai 1916 [2] |
|||
|
Die Festung
verfügte über einen Kampfblock im vorderen Teil der Anlage, zwei
Seitenkoffer zur Verteidigung vor Infanterieangriffen und über eine Kaserne
im hinteren Teil. Die Decken und die am meisten exponierten Wände waren aus
bis zu zwei Meter dicken Stampfbeton, der schichtweise aufgetragen wurde.
Weniger gefährdete Teile waren aus Bruchstein. Teile der
Kasemattenvorderwand sowie die Fassungen der Kuppeln auf dem Dach wurden mit
Südtiroler Granitblöcken verstärkt. Diese wurden mit der Bahn nach Tarvisio
transportiert, dann mit Pferdewagen bis Kluze und mit Ochsengespannen durch
einen Tunnel zur Baustelle gekarrt. Nach den Erzählungen war der k. u. k. Hoflieferant für Brot Karel Pirc aus Bovec. Jeder Soldat erhielt 2 Kilo Roggenbrot, die für 2 Tage reichen mussten. Zu besonderen Anlässen steckte er in einen der Laibe ein Goldstück. Danach trank die gesamte Mannschaft auf Rechnung des Finders. [3] |
|||
|
|
|||
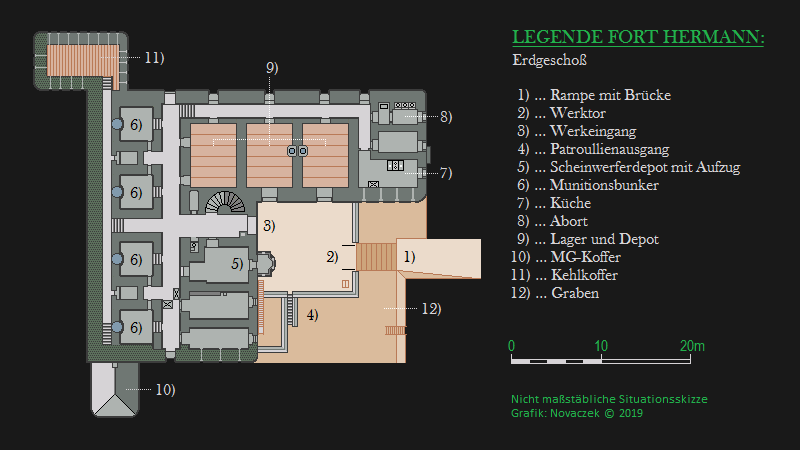 |
|||
|
|
|||
|
WEGBESCHREIBUNG |
|||
| WERKSKIZZE | |||
|
|
|||
|
|
||
|
Fotobesuch 18. AUGUST 2011 |
|||
|
Kaverne (Foto oben) am
Beginn der Zufahrtsstraße. Der Hof des Forts mit dem Haupteingang (links im Schatten) am Ende der Zufahrtsstraße. Blick in die Innenräume (Mannschaftskasematten) Südseite: (feindseitige) Geschütz-Kasematten mit fehlender Stahlpanzerung, siehe Text auf Schautafel [2] Ansicht Südostseite ("Linke Flanke")
Ansicht vom Graben aus, links der Koffer mit der Maschinengewehrstellung. |
|||
|
|
|||
|
FUSSNOTEN |
|||
|
|
|
||